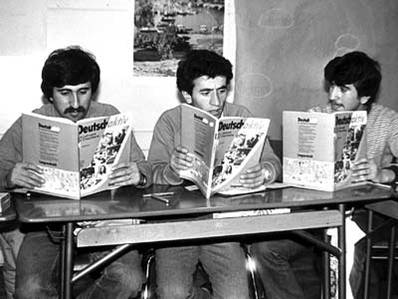Ein Unterrichtsentwurf mit dem Gedicht Ich traume von Mehmet Arat
Unterrichtsentwurf: Agnieszka Tokarska, NKJO Radom. Bearbeitung: Ewa
Turkowska
Der Text wurde nicht veröffentlicht. Beim Zitieren geben Sie die Namen der
Autorinnen und die Adresse der Web-Seite an.
Abkürzungen:
SF - Sozialform
FU –
Frontalunterricht
PL – Plenum
GA –
Gruppenarbeit
PA – Partnerarbeit
EA – Einzelarbeit
L – der Lehrer,
die Lehrerin
S, Sch – der Schüler,
die Schüler
LV - Leseverstehen
HV – Hörverstehen
1. Text und Begründung der Textwahl
Ich träume
Mehmet
Arat
Ich träume von
einer Welt
In
der alle leben können ohne Geld
Ohne
Hass ohne Streit
Ich
möchte leben irgendwo
Ohne
Sorgen ohne Not
In
einer sauberen Umwelt
Ohne
Schmutz ohne Dreck
Ich
möchte es erleben
Irgendwo
glücklich zu sein
Dass
ich nicht mehr weinen muss
Ich
möchte leben in einer Gesellschaft
Wo
die Leute zärtlich zueinander sind
Und
die Liebe groß geschrieben wird
Ich
träume von einer Welt
In
der keiner herrscht
Frei
von Unterdrückung
Und
ohne Klassen
Ich
träume davon die Freiheit
Zu
genießen
So
was sie bedeutet
Und
so wie sie ist
Ich
träume davon
Dass
meine Träume einmal Wirklichkeit
Werden
Deshalb habe
ich aufgehört zu träumen
Und
habe die Ärmel aufgekrempelt
Für
die Verwirklichung dieser Träume
Selbst
etwas zu tun
In:
Mummert, Ingrid: Nachwuchspoeten. Jugendliche schreiben literarische Texte im
Fremdsprachenunterricht Deutsch. Klett, München 1989, S. 14.
Begründung der Textwahl
Ich habe das Gedicht “ Ich träume“ gewählt, weil ich denke, dass er für
meine Schüler gut geeignet ist. Beim Suchen habe ich daran gedacht, dass
der literarische Text die Neugier bei meinen Schülern wecken soll. Das Gedicht
wird von einem gleichaltrigen Jungen geschrieben, der seine Träume beschreibt.
Die Schüler
besuchen erst die zweite Klasse Lyzeum, aber das ist die erweiterte Gruppe,
deshalb glaube ich, dass solcher literarischer Text geeignet für sie ist. Der
Text entspricht sowohl dem Alter als auch den Bedürfnissen der Schüler. In der
Zeit des Erwachsenwerdens träumt man sehr oft und von vielen Sachen. Politische
und gesellschaftliche Themen gehören zum Alltag der Schüler. Deshalb finde ich
Schwierigkeitsgrad und Thema für die
Schüler angemessen.
Der Umfang des
Textes ist gering. Das Gedicht hat auch einfache, überschaubare Struktur. Es
fehlt die Handlung, aber es lädt zum Nachdenken ein.
Der Wortschatz ist nicht kompliziert, mit guter Vorentlastungsphase gibt es
eine groβe Chance, dass die Lernenden den Text gut verstehen. Es gibt wenige
schwierige grammatische und lexikalische Mittel, die die Arbeit mit dem Text
erschweren könnten.
Der Text bringt auch die landeskundlichen Kenntnisse über das Zielspracheland.
Es wird das Problem der Minderheiten in Deutschland erwähnt. Das Gedicht bietet
Einblick in die gesellschaftliche Realität des fremden Landes. Die heutige Welt
ist eben unruhig, voll von Sorgen und Not, deshalb können sich die Schüler mit
dem Autor identifizieren. Das Gedicht stellt eine realistische Situation, den
Alltag eines jungen Türken in Deutschland, dar. Dieser fremdsprachige Text
bringt etwas, was für das Zielspracheland typisch ist. Es zeigt die
Kindergeneration der Gastarbeiter, die unter Identifikationsproblemen leidet
und mit der deutschen Umwelt nicht zurecht kommen kann. Die Schüler erfahren
etwas über Intoleranz der deutschen Gesellschaft gegenüber Ausländer, die schon
die rechtmäßigen Bürger der BRD sind.
Dank dem Einsatz
der Lyrik im Fremdsprachenunterricht wird die ästhetisch-poetische
Rezeptionsfähigkeit der Schüler entwickelt. Das Gedicht kann sowohl als
Schreibvorlage als auch als Sprechanlass dienen. Die Schüler haben Möglichkeit
zur Meinungsäußerung und Stellungsnahme in erwähntem Problem.
2. Unterrichtsentwurf
Klasse/Gruppe: 2. Klasse mit dem
erweiterten Programm in Deutsch
Schultyp:
allgemein bildendes Lyzeum
Unterrichtsjahr: 2.
Wochenstundenzahl: 5 pro Woche
Schülerzahl: 14
Sitzordnung: fünf Tische nebeneinander in vier Reihen
Thema: „Ich träume
von einer Welt ...“
GROBZIEL:
Schulung des freien Sprechens und kreativen Schreibens und Vermittlung der
landeskundlichen Informationen über Gastarbeiter in Deutschland
| INTERAKTIONEN |
DIDAKTISCHER
KOMMENTAR |
1.Einstiegsphase
1.Die L. zeigt den Sch. ein Bild (Anlage 1) und fragt, was die Sch. sehen.
Die freiwilligen Sch. antworten. Sie fragt die Sch. nach Alter der Leute, aber
auch nach Ort, wo sie sich befinden, was bedeuten die Bücher, die sie lesen,
u.s.w. Die Sch. vermuten, wer das sein kann. Wenn sie nicht erraten, dann sagt
die L., dass die Leute Gastarbeiter heißen.
2.Den Sch. wird ein kurzer Text ( Anlage 2) über Gastarbeiter vorgegeben.
Sie lesen ihn still und dann stellt die L. die Frage, wer ein Gastarbeiter ist.
Der Begriff wird geklärt. Sie sagt auch, dass die Träume der Gastarbeiter von
neuer Welt am Anfang und während ihres
Aufenthalts in neuem Land anders aussahen. Die S überlegen, wovon die Gastarbeiter
träumten. Dann fragt sie, wovon die Sch. träumen, wie sie sich die Welt
vorstellen.
3.Die L. schreibt an die Tafel den Anfang des Satzes „Ich
träume von einer Welt .....“ und
verteilt an die S Kärtchen
in der Form von Sprechblasen, worauf einige Traume aus dem Gedicht
geschrieben sind:, z.B "ohne Hass", "ohne Streit", "ohne Not", "
Freiheit geniessen" , "saubere Umwelt" u.a. Die Begriffe werden erklärt. Die
S kommen an die Tafel und kleben die Kartchen um den Kern des
Assoziogramms. Dann bekommen die Sch. Kärtchen, die Form der
Sprechblasen haben. Sie
schreiben darauf ihre Traume von einer glucklichen Welt. Wenn die S
Probleme mit dem Wortschatz haben, hilft ihnen die L.
4.Die L. bittet alle an die
Tafel zu kommen und ihre Sprechblasen daran zu kleben. Die Sch. lesen alle Träume still und besprechen
alles kurz. Die Sch. gehen auf ihre Plätze zurück. |
Ziel: Einführung ins Thema, lexikalische Vorentlastung
1.Die L. benutzt zuerst visuelle Hilfe, die
das Bild leistet, um das Verstehen des Themas zu erleichtern. Das Interesse der
Schüler an dem Thema wird geweckt.
2.Den Schülern wird ein kurzer Text
angeboten, der eine besondere Bedeutung hat, weil das Gedicht, das gleich
präsentiert wird, an historische und gesellschaftliche Kontexte gebunden ist.
Dank dessen können die Schüler über im Text angesprochenes Thema schon früher
erfahren.
3.Das Ässoziogramm, das die Schüler erganzen, führt sie
in das Thema ein und leistet lexikalische Hilfe. Die Begriffe kommen direkt aus
dem Gedicht, auf diese Weise werden Wortfeldern vorgegeben, mit denen die
Schüler arbeiten werden.
Die S konnen auch ihre eigenen Träume von der Welt ausdrücken. Der Wortschatz wird erganzt.
|
2. Präsentationsphase
1.Die Sch. bekommen das Gedicht mit Lücken (Anlage
3) zum Ergänzen. Jedes Paar füllt die leeren Stellen aus. Danach präsentieren
manche S ihre Gedichte. Die Lösungen werden verglichen.
2.Die L. liest das Gedicht im Original vor. Die Sch. bekommen den Auftrag, ihre Lösungen zu
überprüfen..
3.Die L. lässt die Sch. das alles unterstreichen, was sie im Gedicht
verstanden haben. Sie fragt, welche Wörter übrig geblieben sind (nicht unterstrichen). Alle
Wörter, die Sch. erwähnen, werden durch Kontextualisierung, Körpersprache oder
Zeichnen an der Tafel erklärt z. B. Hass ist Antonim der Liebe.
Die L. verteilt die letzte
Gedichtsstrophe an die Sch. Sie fragt, was der Autor vorgenommen hat und womit
er aufgehört hat. Die Sch. antworten auf die Frage.
4.Die L. stellt offene
Fragen zum Text um zu überprüfen, ob die Schüler den Text verstanden haben. Die S erkennen, dass man aktiv sein muss, um die Träume zu verwirklichen. |
Ziel: Verstehen des
Textes
1.Den Schülern wird
das Gedicht mit Lücken angeboten, um sie zu zwingen, das Gedicht intensiv zu
lesen, in die Struktur und Bedeutung des Gedichts einzudringen. Die S bekommen
den Text ohne die letzte Strophe, in der sich der Wendepunkt des ganzen Textes
befindet.
2.Indem das Gedicht vorgelesen wird und die Schüler die Lücken
vervollständigen müssen, wird der auditive Lernkanal aktiviert. Das
Hörverstehen wird auch geübt.
3.Die L. lässt die Schüler das Verstandene
unterstreichen, die Sch. markieren unbewusst auch neue Wörter, die sie
nichtgekannt haben, aber sie haben sie aus dem Kontext erschlossen. Diese Semantisierungstechniken
(Kontextualisierung, Körpersprache oder Zeichnen) verursachen, dass die Schüler
nachdenken müssen und nicht nur bloß polnische Übersetzung notieren.
Die letzte
Strophe wird am Ende präsentiert, weil sie ganz anderes Klima hat.
|
3.
Interpretationsphase
1. Die
L. lässt die Sch. das Gedicht kurz schriftlich in der Zielsprache kommentieren.
Das machen sie zu zweit.
Die
Ergebnisse der Arbeit werden von freiwilligen Sch. vorgelesen.
2.Die
L. stellt Hilfsfragen, die Sch beantworten. Sie richtet auch ihre
Aufmerksamkeit auf den Namen des Autors. Sie fragt, ob der Name deutsch ist.
Die Sch. stellen die Vermutungen, woher der Autor kommen könnte. Erraten die
Sch. es nicht, erläutert die L., dass er ein Türke ist und in Deutschland
wohnt. Sie fragt, was er hier macht. Die Sch. stellen Hypothesen und verwenden
dazu Informationen, die sie am Anfang des Unterrichts bekommen haben. Sie
erraten, dass der Autor ein Gastarbeiterkind ist.
3.Die L. fragt, wie sich der Autor die Welt vorstellt, warum träumt er
davon, wie seine Wirklichkeit aussieht, warum beklagt er sich darüber. Die Sch.
geben ihre Vorschläge.
|
Ziel: Erkennen der Gesamtaussage des Textes und Vermittlung der
gesellschaftlichen Situation des Zielsprachelandes.
1.Dank des kurzen spontanen Kommentars nach dem Lesen und Hören des Textes
haben die Schüler Möglichkeit, eigene Eindrücke und Emotionen auszudrücken. Auf
diese Weise können sie ihre wirklichen Meinungen präsentieren. Sie machen das
in schriftlicher Form, um Schweigen der Schüler zu vermeiden, die oft Angst von
lauten Meinungsäußerungen in der Zielsprache haben.
2.Wenn die Schüler die Gesamtaussage des Textes
erkennen, können sie frei sprechen. Die Sch. haben Möglichkeit, monologisches
Sprechen zu üben. Die Sch. verwenden Deutsch zum Mitteilen ihrer Meinung.
|
|
4. Textverarbeitungs- und Übungsphase
Die L. lässt die Sch. das Parallelgedicht schreiben, damit sie eigene
Träume ausdrücken können.
Die fertigen Arbeiten
hängen sie an die Pinwand und vergleichen ihre Texte miteinander. |
Ziel: Entwicklung des
kreativen Schreibens
Die Sch. können kreativ
sein und eigene Vorschläge der Träumrealisierung schriftlich fixieren.
Die Arbeiten der Schüler
werden in Plenum präsentiert, weil die Sch das Bedürfnis haben, ihre Arbeiten
den anderen zu zeigen.
|
3. Anlagen
Anlage 1. Einstiegsbild Gastarbeiter
Quelle: Wagner,
M. (2003), Blidstrecke: Gastarbeiter. http://www.sueddeutsche.de/muenchen/bildstrecke/898/65833/p0/?img=1.1
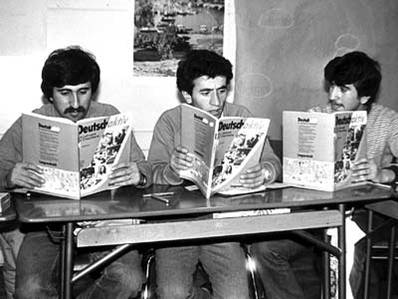
Anlage 2. Informationen über Gastarbeiter
In Deutschland, Österreich und der Schweiz brauchte man in der 60er
Jahren die Arbeiter. Zuerst kamen nur Männer aus Italien, Spanien, Portugal,
Türkei, Jugoslawien und Griechenland. Sie arbeiteten oft viele Jahre in den
„Gastländern“ und ihre Familien waren in der alten Heimat. Sie wollten nur ein
paar Jahre bleiben, um Geld zu verdienen. Als die Männer Wohnung fanden, kamen
auch die Frauen mit Kindern. Aber sie konnten kein Deutsch. Die Kinder gingen
in die Schulen. Jetzt leben sie in Deutschland und das Land der Eltern kennen
sie nur vom Urlaub.
Bearbeitet nach:
Moment mal 2. Podręcznik do jęz. niemieckiego dla młodzieży i dorosłych. Von Martin Muller. Rea Warszawa, S. 66-67.
Anlage 3. Gedicht mit Lücken zum Ergänzen (ohne die letzte Strophe).
Ich träume
Mehmet Arat
Ich träume von einer
Welt
In der alle leben
können ohne ...........
Ohne ......... ohne
..........
Ich möchte leben
irgendwo
Ohne .............
ohne .........
In einer sauberen
Umwelt
Ohne .............
ohne ..........
Ich möchte es
erleben
Irgendwo glücklich
zu sein
Dass ich nicht mehr
.............. muss
Ich möchte leben in
einer Gesellschaft
Wo die Leute
............. zueinander sind
Und die Liebe groß
geschrieben wird
Ich träume von einer
Welt
In der keiner
herrscht
Frei von
......................
Und ohne
..................
Ich träume davon die
Freiheit
Zu genießen
So was sie bedeutet
Und so wie sie ist
Ich träume davon
Dass meine Träume
einmal Wirklichkeit
Werden
4. Bericht über den Stundenverlauf
Am Anfang habe ich das Bild mit den Gastarbeitern gezeigt, was den Schülern
gefallen hat. Sie waren durch das Bild ermuntert und haben gern auf die
einfachen Fragen zum Bild geantwortet. Sie hatten keine Ahnung, wer das sein
kann. Die Nationalität, die Bücher und andere Merkmale haben sie gut erraten,
aber sie wussten nichts über Gastarbeiter in Deutschland. Deshalb musste ich
diesen Begriff selbst einführen.
Als sie sich mit dem kurzem Text über Gastarbeiter beschäftigten, waren sie
bereit, über sie zu sprechen. Das machte den Schülern Spaß, dass sie schon mehr
über das Thema erfahren haben. Mein Ziel, das Interesse der Schüler an dem
Thema zu wecken, wurde realisiert. Dabei war die Atmosphäre ganz locker und die
Schüler haben sich spontan geäußert.
Es war schwierig, von Gastarbeiter zu Träumen zu kommen. Weil ich alles auf deutsch erklärt habe, und das war
eine längere Aussage, haben die Schüler am Anfang nicht begriffen, worum es mir
geht. Deshalb musste ich das noch einmal wiederholen.
Als ich den Satz „ich Träume von einer Welt....“ und rund herum die
Begriffe an die Tafel geschrieben habe
und wir zusammen die Wörter geklärt haben, hatten die Schüler keine andere Ideen als diese, die an die
Tafel standen und das hat mir nicht gefallen. Niemand entschied sich, etwas
eigenes zu schreiben und das ist schade. Aber danach haben die Schuler schöne
Träume ausgedrückt. Und das war mein Ziel. Sie freuten sich auch darüber, dass
sie ihre bunten Sprechblasen an die Tafel kleben konnten.
Ich habe gesagt, dass ich für sie die Gedichte vorbereitet habe und die
Schüler haben mit Erstaunen geguckt. Eigentlich wollten sie keine Gedichte.
Jetzt war das Klima nicht besonders gut. Ich bemerkte gleich, dass die Schüler
nicht gern mit solchen Texten arbeiten. Aber sie hatten keine andere Wahl, sie
mussten sich mit dem Gedicht vertraut machen. Es war gut, dass ich
Partnerarbeit geplant habe, zum Vervollständigen der Gedichtlücken. Aber die
Ergebnisse der Arbeit haben mich überrascht. Die Schüler haben die leren
Stellen ergänzt, nicht immer alle, aber am meisten deshalb, dass sie nicht alle
Wörter, die sie einsetzen wollten, in Kopf hatten.
Als die Schüler den Auftrag bekommen haben, das Gedicht kurz zu
kommentieren, hatten sie Probleme mit Meinungsäußerungen. Sie wussten
eigentlich nicht, was sie schreiben sollten, oder fürchteten die Stellung zum
Gedicht zu nehmen.
Mit der Interpretation des Gedichts war noch schwieriger, die Schüler
hatten Schwierigkeiten mit freiem Sprechen. Ich musste viele zusätzliche Fragen
stellen, um die Informationen aus ihnen herauszuholen. Ich habe gesehen, dass
sie lieber auf polnisch sprechen wollten, aber einerseits versuchte ich sie zu
zwingen, dass sie sich in der Zielsprache äußern, andererseits würde die
Interpretation bestimmt schneller gehen, wenn sie in der Muttersprache reden
könnten. Aber ich habe festgestellt, dass sie doch eine erweiterte Klasse sind
und sie sollen diese Möglichkeit zu benutzen, eigenes Deutsch zu probieren.
Deshalb wurden die schriftlichen Arbeiten der Schüler zum kreativen
Schreiben in demselben Unterricht nicht präsentiert. Wir haben das erst in
einer Woche realisiert, aber dann hat das schon nicht so großen Spaß gemacht.
Alle Arbeiten wurden mit Pluspunkten belohnt und darüber haben sich die Schüler
gefreut.
Arbeit mit literarischen Texten ist nicht leicht, man muss alles sehr gut
vor dem Unterricht durchdenken. Aber ich finde, dass die Erfahrung mit solchen
Sachen auch sehr wichtige Rolle spielt. Sonst klappt es auch die Stunde mit dem
besten literarischen Text auch nicht. Meinen Unterricht habe ich mir anders
vorgestellt, manches habe ich nicht vorausgesehen, aber die Ziele, die ich mir
gestellt habe, habe ich fast im Ganzen realisiert.
SPIS TRESCI/ INHALT